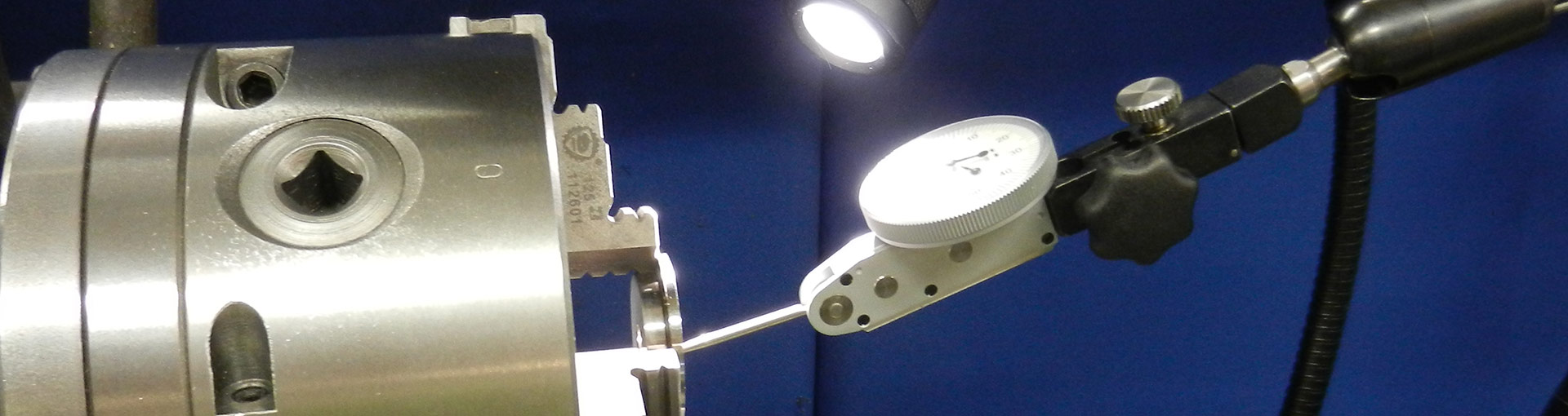Beleuchtungsstärke (Lux, lx)
Die Beleuchtungsstärke beschreibt, wie viel Licht auf eine beleuchtete Fläche fällt.
Die Beleuchtungsstärke von 1 Lux tritt auf, wenn ein Lichtstrom von 1 Lumen gleichmäßig über eine Fläche von 1 m2 verteilt wird.
Farbtemperatur (Kelvin, K)
Die Farbtemperatur der Farbe von einer Lichtquelle wird durch den Vergleich mit der Farbe eines „schwarzen Strahlers“ bestimmt und in einem Farbkoordinatensystem gemäß Plank‘schem Kurvenzug angegeben. Eine Glühbirne mit warmem Licht hat z. B. eine Farbtemperatur von 2.700 K. Eine tageslichtähnliche Lichtquelle kann eine Farbtemperatur von 6.000 K haben.
Die Farbtemperatur muss immer in Kombination mit der Farbwiedergabe angegeben werden. Bei Lichtquellen, die kein Licht durch Erhitzen erzeugen, was heutzutage üblich ist, wird der Begriff korrelierte Farbtemperatur (CCT) verwendet, bei dem der Kelvin-Wert grafisch berechnet wird, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie das Licht wahrgenommen wird. Dies gilt beispielsweise für LEDs, Leuchtstofflampen, Metallhalogen- und Natriumhochdruckleuchtmittel.
Farbwiedergabe (Ra oder CRI)
Der Begriff Ra (Rendering Average) wird in Schweden verwendet, während der Begriff CRI (Color Rendering Index) international gebräuchlich ist.
Je nach Verwendung werden unterschiedliche Anforderungen an die Farbwiedergabe gestellt. Eine natürliche Farbwiedergabe ist immer von Vorteil. Eine schlechtere Farbwiedergabe kann niemals einen Mehrwert schaffen.
Das Maß für die Farbwiedergabe sind die Farbwiedergabeeigenschaften der Lichtquelle. Dies wird meisten mit dem Farbwiedergabeindex Ra angegeben.
Der Farbwiedergabeindex Ra gibt an, wie gut das verglichene Licht einem Referenzlicht entspricht. Um den Ra-Wert bestimmen zu können, wird die Fähigkeit des betreffenden Lichts, Farben wiederzugeben, mit der des Referenzlichts verglichen. Hier werden acht standardisierte Testfarben verwendet. Zusätzlich wurden sechs, etwas stärkere Standardfarben entwickelt, um einen genaueren Messwert zu erhalten, das System hat die Bezeichnung Ra14. Je geringer die Farbabweichungen sind, desto höher ist die Ra-Zahl, die das Licht erhält. Eine Lichtquelle mit Ra = 100 gibt die Farben im Vergleich zum Referenzlicht optimal wieder. Je niedriger der Index, desto schlechter ist die Farbwiedergabe.
Die Farbwiedergabe Ra muss immer zusammen mit der Farbtemperatur Tf angegeben werden.
Einige Beispiele für Ra-Index:
- Glühlampe 100
- Halogen-Glühlampe 100
- Tageslicht 100
- Tageslicht-Leuchtstoffröhre 85
- Tageslicht-Leuchtstoffröhre spezial 95
- Metallhalogenleuchten 85-92
- Leuchtstoffröhre 52
- Quecksilberlampen 50
- Hochdrucknatriumlampen 20
Lichtstrom (Lumen, lm)
Der Lichtstrom bezieht sich auf die Gesamtstrahlung innerhalb des sichtbaren Bereichs, die von einer Lichtquelle ausgeht. Der Lichtstrom ist eine Lichtleistung und kann in einigen Sonderfällen auch mit dem Begriff Watt (W) bezeichnet werden.
Lichtfarbe
Die wahrgenommene Lichtfarbe lässt sich relativ gut mit der Farbtemperatur beschreiben. Die Farbgruppen können in drei Hauptgruppen unterteilt werden:
- Warmweiß < 3.000 K
- Neutralweiß 3.000-5.000 K
- Kaltweiß oder Tageslicht > 5.000 K
Trotz der gleichen Lichtfarbe können Lichtquellen aufgrund unterschiedlicher spektraler Zusammensetzung unterschiedliche Farbwiedergabeeigenschaften aufweisen.
Lichtausbeute (Lumen pro Watt, lm / W)
Die Lichtausbeute gibt an, wie viel Licht in Lumen pro verbrauchtes Watt erzeugt wird. Gleichzeitig ist dies ein Maß für die Wirtschaftlichkeit einer Lichtquelle.
Licht und Strahlung
Mit Licht meinen wir elektromagnetische Strahlung, die vom Auge wahrgenommen wird. Im Auge entsteht durch diese Strahlung ein Helligkeitserlebnis. Hierbei geht es um eine Strahlung im Wellenlängenbereich von 380 bis 780 Nanometern. Dieser Lichtbereich bildet nur einen sehr kleinen Teil, ein Spektrum, des Bereichs, den die Strahlung ausmacht.
Lichtstärke (Candela, cd)
Eine Lichtquelle verteilt normalerweise ihren Lichtstrom unterschiedlich stark und in mehrere Richtungen. Die Intensität in einer bestimmten Richtung wird als Lichtstärke bezeichnet.
Leuchtdichte (Candela pro Quadratmeter, cs/m2)
Die Leuchtdichte ist die wahrgenommene Helligkeit einer Oberfläche oder einer Lichtquelle.
Flimmern
Flimmern kann vom Auge wahrgenommen werden oder bei höheren Frequenzen nicht direkt sichtbar sein, aber dennoch störend wirken. Flimmern ist ein Problem, das entsteht, wenn Leuchten mit einer zu niedrigen Stromfrequenz betrieben werden, bei Maschinenarbeit kann zudem ein sogenannter Stroboskopeffekt auftreten.
Flimmern sollte vermieden werden, da es zu Beschwerden wie Augenermüdung und Kopfschmerzen führen kann. Heutzutage sind die meisten Leuchten mit sogenannten HF-Vorschaltgeräten ausgestattet, wodurch das Flimmerrisiko gering ist. Beim Dimmen ist das Flimmerrisiko größer.

 SE
SE
 UK
UK
 FR
FR